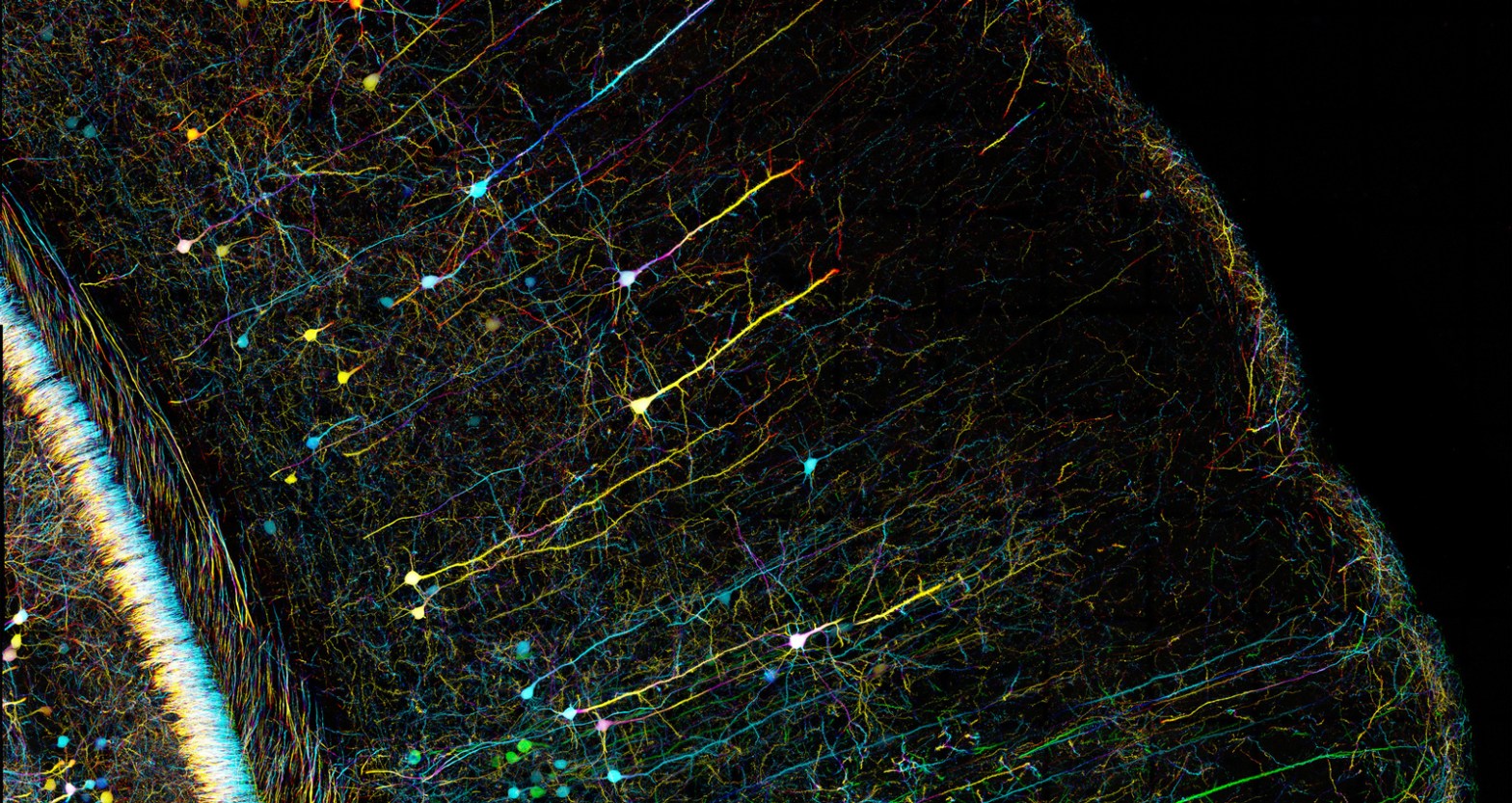Schuberts G-Dur-Sonate hören mit Arno Lücker.
»8. Dezember 1826 (Mariä Empfängnis): Ich begab mich um 8 ½ Uhr zu Spaun. […] Dann kam Schubert und spielte ein herrliches, aber melancholisches Stück von seiner Komposition. […] Endlich soupierte man herrlich. Alles war sehr lebhaft und aufgeweckt. Zuletzt fing alles an zu rauchen. […] Um 12 ¾ trennte man sich.«
Diese Worte des aus Würzburg stammenden Juristen Franz von Hartmann, der 1895 im damals biblischen Alter von 87 Jahren in Graz starb, umschreiben einen künstlerisch intensiven wie offenbar feucht-fröhlichen Abend in Wien. Die Wiener Zeitung meldete am Tag darauf, also am Samstag, den 9. Dezember 1826, dass die Leipziger Herbstmesse eine größere Menge von Büchern geliefert habe; mehr als von allen bisherigen Herbstmessen überhaupt. Ignaz Schuppanzigh annoncierte unter »Musikalische Anzeigen«, dass »das zweyte Abonnement seiner Quartetten im Saale der Gesellschaft der Musikfreunde unter den Tuchlanden (rothen Igel) Sonntags, den 10. December 1826 Nachmittags von halb 5 bis halb 7 Uhr beginne.« Außerdem sei, so die entsprechende Verlautbarung unter der Überschrift »Kunst=Nachricht«, das »Lied der Emma, aus dem romantischen Drama: ›Der Erbvertrag‹ In Musik gesetzt und mit Begleitung der Harfe oder des Pianoforte und des Waldhorns eingerichtet, vom churfürstlich Hessen-Cassel’schen Hof=Capellmeister Ludwig Spohr« in der J. Hermann’schen Kunst=und Musikhandlung erschienen. Gut zu wissen.
Von dem Konzert im Hause des engen Schubert Freundes Joseph von Spaun (1788-1865) – oder sagen wir besser: von dem musikalischen Gelage unter Männern – ist fürderhin nicht die Rede. Warum auch? Schien doch der traditionelle Salonkonzert-Kreis um Schubert sich im rein Privaten zu versammeln.
Stellen wir uns diesen Abend näher vor. Die Freunde Schuberts erlaben sich in der Wiener Wohnung Spauns an der Schubertschen Klavierkunst. Wird während der Aufführung schon getrunken? Vermutlich ja. Versunken sitzen die Männer da. Am Hammerflügel der in die Musik vertiefte Schubert. Ist das Instrument gestimmt? Ja, bestimmt. Hatte Schubert einen Umblätterer? Oder hat er das Werk nur skizziert – und sich der Musik halb vorkomponiert, halb improvisatorisch hingegeben? Hatte er vielleicht nur ein paar Zettel auf dem Flügel liegen, den Rest also tatsächlich frei fantasiert und erst später in Noten gesetzt?
Schubert jedenfalls beginnt mit dem ersten Akkord. Ein sonorer G-Dur-Klang in Terzlage, fast süßlich, aber nicht selbstmitleidig. Nie. Pianissimo. Ein 12/8-Takt. G-Dur, ein kurzer Dominantseptakkord dazwischen, wieder der schon bekannte G-Dur-Klang, wieder die mit einer Septe in der Mittellage versehene Vorschaltung. Dann, zu Beginn des zweiten Taktes erneut der G-Dur-Akkord in Terzlage; doch geht es jetzt weiter, wohlweißlich mit der G-D-Quinte im Bass; ein kurzes Aufschwellen, eine jetzt längere dominantische Hinführung – zurück zu dem Anfangsklang. Ist das wirklich das Thema? Gar etwas zum Mitsingen? Schubert öffnet den Klang: zu Beginn des dritten Taktes ein C-Dur-Akkord, auch in Terzlage. Die Subdominante also, als der immer schönste, landschaftlichste Klang innerhalb einer einfach kadenzierten Grundharmonieumgebung. Sehr bald wieder die Ausgangslage in G-Dur, dieses Mal im Mezzoforte. Langsam ertastet sich Schubert den dynamischen Raum. Was folgt, das sind bestimmt vierzig Minuten mal versunkener, mal fröhlich-galoppierender Musik. Ein Stimmungsbild des Komponisten, vielleicht aus den Emotionen oder Nicht-Emotionen der letzten Tage hervorgegangen. Vielleicht auch nicht. Akkordische Musik, Ton- und Akkordwiederholungen zur Genüge. Häufig wurde diese Sonate auch als »Fantasie« bezeichnet; ihrem teils improvisatorischen, nachsinnenden, rhapsodischen Charakter möglichst gerecht werdend. Klangmusik. Zeitmusik. Trotzdem eine vollwertige Sonate. Und bis heute als diejenige vor den »drei großen letzten Sonaten« c-Moll, A-Dur und B-Dur völlig unterschätzt. Denn hier ist Schubert schon längst bei sich. Eh!
Sviatoslav Richter (1978) beginnt die Sonate in unglaublicher Langsamkeit. Selbst die kurze Sechzehntel-Dominante – der zweite Klang überhaupt – dehnt sich aus für eine himmlische Länge im Kleinen. Richters Interpretation der gesamten Sonate beläuft sich auf 48 Minuten. Daniil Trifonov (2017) ist dagegen in 34 Minuten durch. Es ist dabei überwältigend, mit welchem intensiv aussichtslosen Gefühl der Hörer in die Meditation des depressionskranken Richter gerät. Der Anlauf zum fünften Takt stockt. Richter will nicht mehr, scheint sich selbst aufgegeben zu haben. »Okay, ich spiele noch für euch Klavier. Aber dafür müsst ihr mit mir durch die Hölle der Langsamkeit gehen!«
Doch plötzlich erklingen die Sechzehntel-Vorschläge vor den G-Dur-Akkorden fast doppelt so schnell. Richter spielt mit uns. Ein unfassbares Pianopianissimo dann beim Eintritt des h-Moll-Quartsextakkords. Der die Sonate kennende Hörer kann sich an dieser Stelle der totalen Traurigkeitsentschleunigung kaum vorstellen, wie ein »tänzerisches Seitenthema« bei Richter überhaupt tönen wird.
Auf einem weit weniger metallischen Flügel intoniert Arcadi Volodos (2002) den Beginn ganz sanft. Die von Schubert notierten Akzente dienen Volodos allerdings nur zum Selbstzweck des braven Gestaltens. Mit den Betonungen hat Schubert mehr gemeint; mehr als lediglich die Andeutung, dass hier ein Akkord oder eine einzelne Note herauszuheben ist. Es geht um die Reise ins Innere, um Intensität. Doch die präsentiert uns Volodos etwas zu parfümiert.
Erstaunlich, mit wie wenig Phrasierungskunst Claudio Arrau (1990) den Reigen angeht. Manche Akkordabschlüsse plumpst er geradezu in die Tastatur, als ob Dumbo sich in den Spaunschen Salon verirrt hätte. Das ist dabei von einer berührenden Kindlichkeit. Arrau tut erst gar nicht so, als handele sich hier um geniale Erfindungen, für die jemand sofortige Bewunderung erwartet. Die Genialität Schuberts erweist sich hier im großen Ganzen, in der Gestaltung von guten Längen; von guten Längen wunderbar geborgen.
Die oben gestellte Frage: Wie wird Schuberts Instrument bei der privaten Uraufführung der G-Dur-Fantasie-Sonate geklungen haben? So wie das Instrument von Andreas Staier (2009)? Vielleicht. Ein Hammerflügel verfügt über ungleich mehr Klangschattierungen als ein moderner Steinway. Das gibt Staier zu Beginn die Möglichkeit, sich mittels eines fast forschen Tempos jeglichen Selbstmitleids für immer zu entledigen. Die Innigkeit von Staiers Interpretation vermittelt sich zunächst durch den Klang per se. Ein Hammerflügel klingt für sich viel versunkener als ein glattgebügeltes Schwarz-Weiß-Ding aus dem späten 20. Jahrhundert. Hier ruhen die G-Dur-Klänge in der Meerestiefe, hier sehen wir Spaun, Hartmann, Schober, Vogl und Co. ganz in Schuberts G-Dur-Bann eingewoben. Kein Wunder, dass man nach so einem Werk einiges an Zigaretten wegrauchen musste. (Oder eben schon währenddessen.)
Das zweite Thema des ersten Satzes erinnert an Schuberts eigene Ländler.
Die Tonwiederholungen am Ende der drei Takte vor Eintritt eben jenes Seitenthemas wollen bei Richter gar versinken; sie verzögern sich, sie lassen auf sich warten – wie der Depressive im Inneren des Hauses vor der Tür, der ganz behutsam zu einem Spaziergang ermuntert werden muss, um ihn der segnenden Wirkung von Vitamin-D-Sonnenlicht und Gehirnbewegung liebend auszusetzen. Einzig bei Richter klingt das Seitenthema dann auch keineswegs nach Ländlerfrieden oder gar Idylle. Richter versteht das »Molto moderato e cantabile« Schuberts richtig – und präsentiert uns das punktierte zweite Thema als Teil eines ganzen langsamen Satzes. Das ist von erschütternder Traurigkeit, der man sich nicht jeden Tag aussetzen kann.
Ganz niedlich, wie spröde und trocken die Staccato-Oktaven bei Volodos plingen. Doch Volodos macht einen großen Fehler: Er sucht die Binnengestaltung; mit kleinen Crescendi und Decrescendi versucht er, »Leben« in die Bude zu bekommen. Doch das Leben steckt bei Schubert im Tod, im Stillstand, in der reinen Anschauung von Klang. Wieder zu viel Parfüm. Zu wenig Schubert.
Da erscheint der Unterschied zu der Interpretation von Arrau als umso bedeutsamer. Arrau nimmt das Seitenthema in einem fast prankigen Mezzoforte – und siehe da: Es tut der ganzen Sache nichts Schlechtes an! Arrau erkennt die Ambivalenz österreichischer Klobigkeit und Selbstzerknirschung in Schubertscher Sonatenform. Mit der schweren Hand eines alten Mannes trifft Arrau, sich selbst dabei ganz einbringend, ins Schwarze.
Staier gibt sich ganz der Glockigkeit seines Instruments hin – und riskiert dabei eine ganz andere Art von zart-ländlicher Derbheit, wenn er die akzentuierten Oktaven in der Höhe des zweiten Themas mit amourösester Verliebtheit, wie beim Spiel zweier Liebender, die sich innigst-brutal nicht mehr loslassen wollen, in die Tasten glockt.
Zu diesem Zeitpunkt hat Trifonov bereits den Rubikon an Selbstbegeisterung schon allein gestisch überschritten.
Bei aller Gestik, bei allem Ausdruckswillen bleibt bei ihm als Erkenntnis des zweiten Themas lediglich die unbedingte Motivation übrig, jedem Klang ganz für sich von den anderen abgesetzt Bedeutungsschwangerschaft zu attestieren. Vielleicht sollte man einfach nicht hinschauen. Trifonov scheidet aus.
Nach unfassbaren 27 Minuten ist bei Richter der erste Satz an seinem Ende angelangt. Da klingt das »Andante« des zweiten Satzes zu Beginn fast schon wie ein Allegretto.
Es ist einer der typischen »langsamen« Schubert-Sätze, in denen der Komponist ein bei einem Spaziergang dahingedachtes Lied pfeift. Dabei sind diese Schubert-Sätze stets rhythmisch vielfältig und eigensinnig, manchmal fast widerständig organisiert. Bei Richter weiß man tatsächlich zunächst nicht, wohin – beziehungsweise: was das Ganze soll! So schlicht und einfach ist der größtmögliche Stillstand des ersten Satzes verflogen? Nein! Die immense Fortissimo-Akkord-Überraschung trifft in der Interpretation Richters ins Mark. Die Pianissimo-Oktav-Gesten anschließend erklären des Rätsels Lösung. Das einfache Spaziergangslied war nur trügende Idylle. Klar. Wie bei Mahler. Nur mit Schubert. Durch den Park der Emotionen.
Im direkten Vergleich zu Volodos wirkt Richters dramaturgischer Plan für den zweiten Satz umso genialer. Denn Volodos macht auch hier den Fehler, sich zu sehr auf seine russisch-romantische Gestaltungsschule zu verlassen, um Schubert gnadenlos zu verfehlen. Betulich werden alle Tongruppen fein säuberlich wegmusiziert. Süß. Auch Volodos wird hiermit von der Liste gestrichen. Für heute.
Zögerlich geht Arrau das Andante an Mutig tritt er dabei immer wieder sanft auf die Bremse. Er denkt in, mit Musik nach. Das ist höchst richtig und hiermit gestattet. Staier fällt zunächst im Vergleich durch die tiefe Stimmung seines Instruments, die eingebauten Verzierungen und die arpeggierten Akkorde auf. Was für ein himmelweiter Unterschied zu Volodos, der sich schließlich auch seine Gedanken über diesen zweiten Satz gemacht haben wird. Doch Staier entspricht der oben kurz geträumten Idee einer Uraufführungssituation viel eher – indem er den Satz wie vom Blatt spielt. Ein Erfinden im Moment. Da muss, da kann Staier mit seinem Instrumentarium bei den Quasi-Schock-Akkorden in h-Moll nach wenigen Momenten gar nicht überraschen. Er spielt das Stück schlicht auf einem Instrument, das wunderschön murmeln kann, surren, singen, versinken… Das reicht. Mehr brauchen wir nicht.
Der dritte Satz – ein Menuett, das man in Anführungszeichen setzen will – scheint direkt von Schuberts eigenen Valses nobles inspiriert, die bereits 1823 entstanden waren. Ohne Vertun könnte der A-Teil dieses dritten Sonatensatzes in einer der Walzer-Sammlungen Schuberts auftauchen. Doch da ist eben jener H-Dur-Mittelteil, der sich vom forschen – eigentlich gar nicht menuettähnlichen – h-Moll-Teil abhebt wie eine transzendent-traumwandlerische Musikinsel inmitten einer recht deutschnassforschen Tanzumgebung.
Unversehens geht Richter in den dritten Satz hinein. Keine Nachdenklichkeit mehr. Dafür Zünftigkeit. Obwohl nur »Forte« vorgeschrieben ist, stampft er im Fortissimo hinfort und versäumt sogleich die Chance des Crescendos im siebten Takt. Wie so oft in den Tanzsätzen der Klaviersonaten Schuberts erleben wir die Dialektik von Forschheiten, ja akkordischen Blockhaftigkeiten und artifiziellen Harmonie- und Rhythmusüberraschungen. Kein einziger Tanzsatz Schuberts eignet sich zum Tanzen.
Plötzlich bleibt eine Oktave auf der dritten Zählzeit hängen, hangelt sich hinüber zur dann unbetonten »Eins«. Wechselspiele von Piano und Pianissimo folgen. Wunderschön hebt Richter die kleinen Betonungen an den leisen Stellen heraus. Im Fortissimo allerdings erweist sich, dass Richter offenbar keine Händchen für die Auswahl guter Instrumente hatte. Hier scheppert es im Flügel als würde Walter White mal wieder ein Meth-Labor schrotten. Der Mittelteil schließlich gelingt Richter in einem feinen Pianissimo. Das dreifache Piano kann er auf dem Instrumentarium der besagten Aufnahme dafür nicht gestalten.
Viel weniger forsch, dafür fast nachdenklich beginnt bei Arrau der dritte Satz. Die nötige Hemdsärmlichkeit ist trotzdem gegenwärtig. Anmutig, wie Arrau sich in den Pianissimo-Inseln an die Schubertschen Längen des ersten Satzes zu erinnern scheint. Als einziger Interpret versteht er den Schluss des A-Teils adäquat. Denn hier »vergisst« Schubert absichtlich die Quinte von h-Moll. Und aufgrund der vielen D-Dur-Stellen dieses Formteils tönt das quintlose h-Moll zum Beschluss wie ein verwegen »falsches« G-Dur. Entrückung im Quasi-Ländler.
Den Allegretto-Schlusssatz beginnt Arrau gar fröhlich und naiv, erfindet Betonungen hinzu. Das ist ein ganz natürliches Klavierspiel ohne Eitelkeiten. Darin ist Arrau immer gut. Musikantentum mit wenig Pedal. Leider auch mit zu wenig Transzendenz. Zu unbesonders. Aber eben nie falsch.
Bei Richter wird angesichts des letzten Satzes schon anfangs deutlich, dass er hier an Tempo aufholen will, was er in wunderbarster Weise im ersten Satz »liegengelassen« hatte. Die leisen Akkordrepetitionen, die die ganze Sonate – mit Ausnahme des zweiten Satzes – prägen, sprechen hier etwas aus, was man Schubert am wenigsten zugestehen mag: Sinn für kindlichen Humor. Da klopft es zwischen »wichtigem« Themenmaterial einfach so dazwischen, es pocht lieblich mahnend. Auch in den galoppartigen Passagen dieses Finalsatzes formt Richter entsprechende Kontraste, hebt einzelne Tongruppen durch Pedalisierung hervor, reitet andere Teile dafür trocken durch die Rondo-Prärie – und geht dabei stets im Sinne eines echten Kehrausfinals nach vorne. Herrlichste Übergänge entstehen durch Richters Hände Kraft. Schubert mag so seine Freunde im Dezember 1826 ebenfalls galant überrascht haben. In einem Rondo sind die schönsten Momente der Wiederkehr des Themas vorbehalten. Da reißt die Bewegung Schuberts einfach vorher ab. Ein musikalisches Fragezeichen in Form einer Pause. »Und, Freunde? Was glaubt ihr, was jetzt kommt?« Das Thema? Ja.
Die geflüsterten Akkordrepetitionen gelingen Staier auf dem Hammerflügel besonders subtil. Auch Staier spielt mit Überraschungs- und Spannungsmomenten und erweist sich als dynamischer und klangfarbenspezifischer Meister unter den hier verglichenen Interpreten. Die sehr lustig in die Tasten geklopften Auftakte der linken Hand machen einfach Freude.
Doch das Herz der ganzen Sonate zeigt sich bei Staier im besagten H-Dur-Mittelteil des dritten Satzes.
Es gab einst eine Folge von »Meister Eder und sein Pumuckl«, in der ausnahmsweise mal alles gut war. Pumuckl war irgendwie – ich weiß den Namen der Folge nicht mehr und bin des Googelns gar müde – zu Geld gekommen oder hatte dem lieben Meister Eder irgendwie Glück gebracht oder etwas Gutes geraten… Jedenfalls durfte Pumuckl so viel Schokolade und Wurst – das waren seine Lieblingsdinge auf der ganzen Welt – essen, wie er nur wollte. Und eine Spieldose durfte er auch haben! Und die klang immerzu, immerzu… Pumuckl war umringt von Glück und Seligkeit. Diese Seligkeit, dieses klingende Glück der pumucklschen Spieldose kann man erleben, wenn man Staier hört. In unendlicher Leisheit singt der Interpret auf seinem wunderschönen Instrument ein Lied von Sorgenfreiheit und Liebe. Hier werden Schuberts Freunde besonders die Ohren gespitzt haben. Hier waren gestandene Männer plötzlich wieder Kinder, um sich im Nachgang wieder Alkohol und Zigaretten zu gönnen. Nun denn. ¶